Plädoyer für Soll statt Muss
Der reale Substanzerhalt fällt Stiftungen angesichts der anhaltenden Niedrigzinslage immer schwerer. Die starre, jährliche Stichtagsbetrachtung sollte deshalb lieber durch eine mittelfristige Soll-Vorschrift ersetzt werden. Diese klare Botschaft ging von den Diskussanten des Stiftungs-Roundtables auf dem Trendforum von portfolio aus.
Podiumsdiskussion mit Peter Anders (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft), Ernst-Ludwig Drayß (Absolute Portfolio Management) und Ann-Grit Schulze (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“). Moderator ist Tobias Bürger.
Das anhaltende Niedrigzinsumfeld macht vielen Stiftungen zu schaffen. Herrn Anders, was sagen Sie Ihren Mitgliedern zur aktuellen Marktsituation?
Peter Anders: Das Umfeld ist natürlich schwierig. Wir sind breit diversifiziert, so dass uns der Absturz noch nicht so stark getroffen hat. Allerdings fordern wir unsere Stiftungen auf, in der Ausgabenpolitik vorsichtiger zu sein. Ich möchte einen Punkt ansprechen, mit dem sich sicher noch nicht jede Stiftung befasst hat: die Satzung. Diese muss geändert werden, weil sich die Anforderungen nicht mehr erfüllen lassen. Unter unseren 580 Stiftungen finden sich viele private Stiftungen. Deren privater Förderer gibt, wenn die Erträge zurückgehen, auch unterjährig Spenden, damit der Förderzweck aufrechterhalten werden kann. Das sehen wir bei Stiftungen der öffentlichen Hand nicht. Die größten Probleme haben Stiftungen, die einen festen Ausgabeplan haben, zum Bespiel durch den Betrieb einer Forschungseinrichtung, eines Krankenhauses oder Museums.
Viele deutsche Stiftungsportfolien bestehen ausschließlich aus Renten. Woran liegt das?
Ernst-Ludwig Drayß: Ich erinnere mich gut, als ich vor 40 Jahren in der Finanzbranche anfing, waren die Zinsen bei acht Prozent und höher. Für mündelsichere festverzinste US-Anlagen bekam man in den 70er und 80er Jahren Renditen im zweistelligen Prozentbereich. Danach hatten wir 30 Jahre lang eine Phase des Finanzkapitalismus mit rückläufigen Zinsen. Wir lebten in einer Zeit, die eigentlich nicht normal war. Normal ist, wenn die Renditen von Zinspapieren niedriger sind als Dividendenrenditen. Aber in dieser Zeit war es genau umgekehrt. Es lohnte sich, in festverzinsliche Anlagen zu investieren. Doch das Anlageumfeld hat sich dramatisch verändert. Mündelsichere Wertpapiere liegen heute bei ein bis zwei Prozent. In der Anlagestruktur spiegelt sich das aber noch nicht wider.
Dürfen Stiftungen von ihren Gremien aus überhaupt höhere Risiken in Kauf nehmen?
Drayß: Die Angst vor der Volatilität und dem nächsten Reporting verhindert, dass Stiftungen anders anlegen als bisher. Ein Familienunternehmen, das nur nach dem nächsten Quartal schaut, wäre schlecht gemanagt. Aber bei vielen Portfoliomanagern – das ist nicht nur auf Stiftungen bezogen – ist die Angst vor der Volatilität der größte Feind.
Frau Schulze, Ihre Stiftung ist 13 Jahre alt. Würden Sie den Umfang des Kapitalstocks und dessen Zusammensetzung skizzieren?
Ann-Grit Schulze: Die Stiftung EVZ wurde 2000 per Bundesgesetz errichtet. Bereits im Errichtungsgesetz wurde für unsere internationale Fördertätigkeit ein Grundstockvermögen von 358 Millionen Euro definiert. Diese Summe stellt unsere harte Wertuntergrenze dar. Seit 2009 sind wir in einer diversifizierte Asset-Allokation investiert, die mittels spezialisierter Fondsmandate umgesetzt wird. Die Risikotragfähigkeit der Stiftung ist hierbei als oberste Prämisse zu nennen. Das heißt, wir fokussieren uns bei der Ausgestaltung der strategischen Asset-Allokation auf die Steuerung von wenigen, aber gut diversifizierten Risikofaktoren. Mittels einer dynamischen Allokationssteuerung erfolgt eine ganzheitliche Risikopositionierung innerhalb taktischer Bandbreiten bei allen liquiden Asset-Klassen. Die Assets in Höhe von 450 Mio. Euro sind im Schwerpunkt in nominale Anlagen investiert. Wir erhöhten allerdings die strategische Aktienquote im Jahr 2012 auf 23 Prozent. Neben Aktien und nominalen Anlagen, wie Government- und Corporates Bonds, haben wir eine zehnprozentige Immobilienquote, die wir ausschließlich indirekt abbilden.
Glauben Sie, dass auch bei anderen, kleineren Stiftungen Taktik ein Thema ist?
Schulze: Sofern die internen Strukturen und Prozesse es ermöglichen, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, um die Finanzierungsanforderung durch die ordentlichen Erträge zu decken. Im Jahr 2011 führten wir einen umfangreichen Strategie-Workshop durch. Als Ergebnis vereinfachten wir unsere Allokation und konnten auf der Ausgabeseite gute Effekte bewirken. Über die Strukturvereinfachungen haben wir in der Vermögensverwaltung im Jahr Kosten von 230.000 Euro einsparen können. Neben der Fokussierung auf die ordentlichen Nettoerträge nutzen wir die taktische Steuerung als Teil des Risikomanagements und als Möglichkeit, ausreichende ordentliche Erträge zu generieren. Ein Beispiel hierfür ist die taktische Übergewichtung der Corporate-Bonds-Mandate ab dem ersten Quartal 2012. Durch die taktische Steuerung konnten wir für das Jahr 2012 insgesamt einen Mehrertrag in Höhe von einer Million Euro generieren.
Anders: Wir haben 25 Prozent Aktien. Stiftungen müssen jährlich einen ordentlichen Ertrag ausschütten und die Substanz erhalten, das geht nicht ohne Aktien. Wir als Stifterverband sind ein Dienstleister. Das heißt, dass wir nicht nur Stiftungen gründen, sondern auch Stiftungen aufnehmen, die vorher selbst gemanagt wurden. Das hat in den vergangenen Jahren zugenommen, weil der Markt schwierig geworden ist. Die kleineren Stiftungen, die zu uns kommen, haben zwischen 70 und 100 Prozent Renten. Wir haben ausgerechnet, was das bedeutet: Als Stiftung dürfen sie nur einen Teil in die freie Rücklage geben, der liegt bei einem Drittel der Erträge nach Abzug der Kosten. Bis 2000 waren es nur 25 Prozent. Das heißt: Von den acht Prozent, die Herr Drayß vor 40 Jahren erwirtschaftet hat, konnten nur zwei Prozent zurückgelegt werden. Die Inflationsrate lag im gleichen Zeitraum bei etwa 3,5 Prozent. Heute haben wir noch schlimmere Verhältnisse. Ich warne davor, zu stark auf Renten zu setzen. Weil wir als Stifterverband auch öffentlich- rechtliche Stiftungen betreuen, können wir uns nicht gänzlich von Bundesanleihen trennen, aber wir haben den Anteil auf etwa 20 Prozent des Vermögens zurückgefahren.
Drayß: Wir haben heute eine Situation, die es 30 Jahre lang nicht gab. Heute bekommen Sie Dividendenrenditen von vier bis sechs Prozent, Corporate Bonds aus dem Investment-Grade-Bereich liegen bei 2,1 Prozent. Die Frage ist: Warum haben wir noch so viele Renten? Der Grund ist, dass wir immer noch hohe laufende Erträge haben. Wir warten, bis sie fällig werden. Erst dann werden wahrscheinlich Aktien gekauft. Man kommt bei Neuanlagen nicht umhin, in Dividenden zu investieren.
Schulze: Definitiv. Das ist auch ein Weg, den wir gehen. Wir haben im vergangenen Jahr das Universum der Corporates-Mandate dahingehend erweitert, dass wir die zulässige High-Yield-Quote auf bis zu 20 Prozent erhöht haben – natürlich nur im Rahmen der Risikotragfähigkeit der Stiftung. Ansonsten bin ich ganz bei Ihnen: Noch verfügen wir über Renten mit hohen Kupons, die allerdings perspektivisch auslaufen. Wir haben daher kürzlich im Aktienbereich Umschichtungen in Titel mit Dividendenstrategien vorgenommen. Berechnungen unseres Controllers haben ergeben, dass es ab dem Jahr 2016 für die Stiftung zunehmend schwierig wird, die Finanzierungsanforderungen aus den ordentlichen Erträgen zu bedienen. Pro Jahr besteht ein Cashflow-Bedarf von zehn bis elf Millionen Euro. Diese Herausforderung ist das zentrale Thema unserer nächsten Strategiesitzung: Welche weiteren Schritte können wir noch unternehmen, um auf die aktuelle Situation zu reagieren?
Was bleibt neben Aktien und Renten noch?
Drayß: Stiftungen haben den Vorteil – anders als berufsständische Versorgungswerke oder Pensionskassen –, dass sie in ihrer Anlagepolitik ziemlich frei sind und eine unbegrenzte Laufzeit haben. Eine Stiftung läuft per se ewig. Die Stiftung kann in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren, in Beteiligungen oder Immobilienanlagen gehen und damit höhere Erträge erzielen. Eine Stiftung muss nicht auf festverzinslichen Anlagen und Aktien sitzenbleiben.
Anders: Wir haben im Moment – wie eben schon gesagt – mehr als 25 Prozent Aktien. Wir haben aber auch unseren Immobilienanteil auf zehn Prozent aufgestockt. Im Rentenbereich sind wir stärker von Bundesanleihen weg und hin zu Pfandbriefen und Unternehmensanleihen gegangen. Wir haben auch Emerging-Markets-Renten beigemischt. Zu Sicherungszwecken nutzen wir außerdem Derivate und suchen unser Heil in der Wertsicherung. Wie Herr Drayß richtig sagte, haben Stiftungen eigentlich den längsten Anlagehorizont – länger als jede Lebensversicherung. Trotzdem wollen die Stiftungsgremien am Ende des Jahres keine Verluste sehen. Das beißt sich. Man kann heute nicht mehr die gleichen Erträge mit dem gleichen Risiko wie in den letzten 20 Jahren erwarten. Die Märkte haben sich verändert. Man muss risikobereiter sein, um einen ähnlichen Ertrag erzielen zu können. Das ist in den Stiftungsgremien oft ein großes Manko.
Gibt es überhaupt adäquate Anlagerichtlinien in Stiftungen, um die Allokation entsprechend den Umständen ändern zu können?
Anders: Viele Stiftungen haben kaum Vorstellungen darüber, wie Anlagerichtlinien aussehen könnten. Sie erwarten das oftmals von uns. Bei öffentlichen Stiftungen sehen Sie je nach Land unterschiedliche Ausprägungen. Wir haben gerade eine Stiftung abgelehnt, mit der wir über eine Aktienquote von 30 Prozent und ein Risikobudget von vier Prozent gesprochen haben. Als wir den Vertrag unterschreiben wollten, war von Werterhalt zu jedem Jahresende die Rede. Das geht nicht, das kann man nicht eingehen. Wir reden mit Gremien, die aus zwölf bis 20 Personen bestehen. Um endlose Diskussionen zu vermeiden, bräuchte man eigentlich einen Finanzausschuss mit drei oder vier Fachleuten. Dieser bildet sich eine Meinung und spricht hinterher intern mit seinen Gremien.
Was haben Sie für Erfahrungen im Gespräch mit Gremien gemacht?
Drayß: Ich bleibe bei meiner Aussage, dass man weniger auf unrealisierte Kursgewinne und Verluste und mehr auf laufende Erträge, Nachhaltigkeit und das Langfristige schauen sollte. Dann wäre auch im heutigen Umfeld das Management wesentlich besser. Man sollte nicht immer nur auf den 31. Dezember schauen.
Anders: Das wäre wünschenswert. Dazu zwei Sätze: Wir haben Wertsicherungsmodelle, die per anno angelegt sind. Wir haben nur ein Wertsicherungsmodell, in dem wir eine Wertsicherung über drei Jahre durchsetzen konnten. In diesem Gremium sitzen Finanzleute von Dax-Vorständen. In den anderen Fällen ziehen die Stiftungen wegen des Bilanzstichtages nicht mit. Sie wollen am Jahresende nicht irgendeinen Verlust ausweisen. Das ist die Mark-to-Market-Bewertung, die keiner sehen will.
Drayß: Stiftungen sollten ein bisschen weniger Angst vor der kurzfristigen Volatilität haben. Dann könnten sie ihre langfristigen Erträge wahrscheinlich auch im heutigen Umfeld deutlich nach oben bringen.
Frau Schulze, ich möchte zum Thema Substanzerhalt kommen. Wie war das bei Ihnen? Vor eineinhalb Jahren gab es hierzu Diskussionen. Was war das Ergebnis?
Schulze: Unsere Rechtsaufsicht ist das Bundesministerium für Finanzen. Wir führten intensive Gespräche, um die Rechtsaufsicht und unsere Gremien davon zu überzeugen, von der starren Stichtagbetrachtung im Jahresabschluss Abstand zu nehmen. Bis vor eineinhalb Jahren hatten wir in der Satzung eine Muss-Vorschrift zum realen Substanzerhalt. Diese wurde in eine Soll-Vorschrift gewandelt. Mittelfristig ist natürlich der reale Substanzerhalt sicherzustellen. Dieses Sichern zum Jahresende kostet aus unserer Sicht unnötige Performance. Nun haben wir mehr Freiheit, die Allokation sinnvoll aufzustellen. Im Vorfeld waren aber sehr viele intensive Sondierungsgespräche zu führen.
Drayß: Man muss die Muss-Vorschrift zu einer mittelfristigen Soll-Vorschrift ändern. Es geht gar nicht anders.
Schulze: Ja, exakt. Die Satzungsänderung war für den Bereich der Kapitalanlagen der Stiftung von essenzieller Bedeutung. Wir verfügen über ein 27-köpfiges Kuratorium, bestehend aus der Legislative – Bundestag, Bundesrat –, aber auch dem Auswärtigen Amt und Regierungsabgesandte von mittel- und osteuropäischen Ländern. Außerdem sitzt im Kuratorium neben Vertretern von Opferverbänden beispielsweise auch ein amerikanischer Rechtsanwalt. Von daher ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gehen konnten.
Zurück zur Asset Allocation von Stiftungen. Sollte Mission Investing für Stiftungen eine Rolle spielen?
Drayß: Die Allokation muss sich verändern, sie muss innovativ sein und sollte im Einklang mit dem Stiftungszweck stehen. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Mission Investments eine gute, nachhaltige und ertragreiche Anlage sind, die langfristig vier Prozent oder mehr bringen, würde ich sagen, ja. Es kann aber auch jede andere Direktbeteiligung sein, solange sie einigermaßen im Einklang mit dem Stiftungszweck ist.
Was genau ist eigentlich Mission Investing?
Schulze: Das sind Unternehmungen, durch die Kapitalanlage den Stiftungszweck im Wirkungsgrad noch einmal zu hebeln. Nehmen wir an, es geht um eine Stiftung, die frühkindliche Förderung als Stiftungszweck hat. Für diese Stiftung wäre eine Möglichkeit, einen Kindergarten beispielsweise mit dem Schwerpunkt der musikalischen Frühförderung zu betreiben oder ein Gebäude zu kaufen, in dem ein solcher Kindergarten betrieben werden kann. Auch wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir finden es aber recht schwierig, ein Vehikel oder eine Möglichkeit zum Investment zu finden, das auf unseren sehr speziellen Stiftungszweck passt.
Anders: Ich weiß, dass der Bundesverband deutscher Stiftungen dieses Thema vor eineinhalb Jahren auf der Agenda hatte. Wir haben es in Teilbereichen in einzelnen Stiftungen umgesetzt. Eine Stiftung, die zum Beispiel Stipendien fördert, kann natürlich auch in einen Fonds investieren, der Stipendien vergibt und daraus einen Ertrag generiert. Wir haben einen anderen Fall, in dem jemand in Afrika den Ärmsten der Armen helfen will. Dieser hat ein Projekt begonnen, in dem er selbst ein SOS-Kinderdorf mit seinem Stiftungsvermögen baut. Das ist reinstes Mission Investing.
Drayß: Ich habe mir über diesen Begriff nicht den Kopf zerbrochen. Aber man übersetzt es oft als zweckbestimmtes Investment. Wenn mit diesen Schlagwörtern und Begriffen eine Investmentpolitik gesteuert wird, geht das meines Erachtens oft schief. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Wir haben davon gesprochen, dass man bei festverzinsten Neuanlagen vier Prozent braucht, aber gar nicht mehr erreichen kann. Ich investiere seit Jahren, so viel ich kann, in Mikrofinanzfonds. Das sind Schuldscheindarlehen an Mikrofinanzinstitute als Fonds verpackt. Diese haben keinen Marktkurs und werden immer nominal bewertet. Nach allen Kosten haben sie eine Rendite von über vier Prozent. Das ist Mission Investing per Definition und passt perfekt zusammen.
Die Stiftung EVZ war in einen Mikrofinanzfonds investiert. Sind Sie es immer noch?
Schulze: Nein, wir haben aus Risikoertragsaspekten deinvestiert. Bei Mikrofinanzprodukten steht ja eher die soziale Rendite im Vordergrund, so dass der Ertragsaspekt grundsätzlich vernachlässigbar ist. Dennoch wurde intern zunehmend die Profitabilität des Fonds diskutiert, da nicht zuletzt hohe Verwaltungs- und Managementgebühren zum Tragen kamen. Als es dann zu einer Änderung in der Vertriebs- und Managementstruktur kam, schmolz das Fondsvolumen zunehmend ab. Im Rahmen von Risikoaspekten und der Gefahr von Illiquidität haben wir den Fonds dann verkauft. Wir haben uns nach anderen Vehikeln umgeschaut, aber nicht das für uns geeignete Investment gefunden. Mikrofinanz finden wir grundsätzlich gut, aber wir sind zurzeit nicht investiert.
Frau Schulze, Sie haben erst kürzlich einen Engagementprozess etabliert. Können Sie das etwas näher erläutern?
Schulze: Im vergangenen Jahr haben wir unseren Engagementprozess als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie implementiert. Bedingt durch die Historie der Stiftung wollen wir auch mit unserem Kapital verantwortungsvoll umgehen und damit nicht gegen die Ziele der Fördertätigkeit arbeiten. Wir überprüfen, wenn möglich, alle Investments, ob sie im Einklang mit dem Vermächtnis Deutschlands hinsichtlich des nationalsozialistischen Unrechts stehen. Wir lassen unsere Bond- und Equity-Bestände regelmäßig von einer Research-Agentur hinsichtlich der Ausschlusskriterien „Menschen- und Arbeitsrechtsverletzung“, „Kinderarbeit“ und „moderne Formen der Zwangsarbeit“ screenen. Auf Grundlage dieser Analyse verschicken wir dann einmal im Jahr Briefe an die Unternehmen aus unserem Portfolio, die gegen unsere Standards verstoßen. Wir definieren uns als kritischen Investor und wollen einen proaktiven Dialog zu den kontroversen Wirtschaftspraktiken international agierender Unternehmen führen. Im letzten Jahr sammelten wir damit sehr gute Erfahrungen. In Teilen war das Feedback zwar sehr verhalten und knapp, in Teilen fanden auch gute Dialoge statt. Wir trafen zum Beispiel die Delegation eines kolumbianischen Minenbetreibers, mit der wir die Kontroversen bilateral diskutieren konnten. Zum Abschluss des ersten Engagementprozesses haben wir Anfang dieses Jahres auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Wir haben Investments in Höhe von 1,6 Millionen Euro deinvestiert. Im Schwerpunkt handelt es sich um drei Unternehmen, die keinen Dialog mit uns führen wollten: Apple, Wal-Mart Stores und Barrick Gold. Darüber hinaus haben wir Shell deinvestiert. Das Unternehmen hat uns zwar geantwortet und in Teilen – soweit wir das einschätzen können – sinnvolle Maßnahmen implementiert. Allerdings sind die Missstände in Nigeria so prekär und dauerhaft, dass wir uns gegen ein weiteres Investment entschieden haben. Wir werden diesen Engagementprozess fortsetzen und in Kürze die nächsten Unternehmen anschreiben. Auch zu unseren Partnern der Kapitalanlage haben wir dieses Jahr einen Engagementprozess aufgesetzt. Dieser führte dazu, dass wir ein HSBC-Mandat wegen des Geldwäscheskandals in den USA kündigten. Auch an diesen Punkten schauen wir also ganz genau hin.
Es gibt die Möglichkeit, Kredite an Einrichtungen zu vergeben, die zum Stiftungszweck passen. Was halten Sie davon?
Anders: Vereinzelt haben wir größere Stiftungen, die Darlehen vergeben haben. Wir können es für die Gesamtheit aber nicht umsetzen. Wir haben Spezialfonds, in denen teilweise 80 Stiftungen investiert sind. Der Spezialfonds selbst kann kein Darlehen vergeben.
Drayß: Kredite direkt zu vergeben, ist in den meisten Fällen administrativ ein Problem. Mittelbar ist es möglich, wie zum Beispiel durch Mikrofinanz. Aber direkt einen Kreditvertrag aufzusetzen, ist theoretisch möglich, praktisch aber schwierig. In Schuldscheine würde ich als Stiftung hingegen schon investieren. Der Reiz daran ist, dass man in der Regel gute Renditen und keinen Marktkurs hat.
Wie ist es um die Sicherung bestellt?
Drayß: Man muss vorher genau hinschauen, wie es um das Ausfallrisiko bestellt ist. Vielleicht ist es bei Schuldscheinen schwieriger, weil es kein Rating gibt und nur wenig Research. Wenn es heute einen Schuldscheinfonds gäbe, würde ich diesen jedem Corporate-Bonds-Fonds vorziehen.
Herr Anders, haben Sie sich mit Private Equity beschäftigt?
Anders: Als wir unsere Spezialfonds global diversifiziert und Hedgefonds hinzugenommen haben, prüften wir auch Private Equity. Wir bündeln viele Stiftungen und bekommen hier ein paar Probleme, die uns keine Private-Equity-Gesellschaft auflösen konnte, wie etwa den J-Curve-Effekt. Wenn zum Beispiel 100 Stiftungen durch das Tal gehen und im nächsten Jahr 20 Stiftungen neu hinzukommen, schöpfen diese den Rahm ab. Es gibt keinen Ertragsausgleich. Hinzu kommt die zum Teil mangelnde Implementierbarkeit in Spezialfonds.
Schulze: Wir werden das Thema auf den nächsten Strategiesitzungen aufgreifen. Aber die Aspekte, die Herr Anders angesprochen hat, sind auch für uns ausschlaggebend. Der Finanzbereich der Stiftung ist extrem schlank aufgestellt. Von daher ist wesentlicher Mehraufwand wegen eines solchen Vehikels untragbar. Die Kostenstruktur, Transparenz und Illiquidität sind weitere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Wir werden andere Wege gehen, um den Herausforderungen an den Kapitalmärkten in den nächsten Jahren zu begegnen.
Gehören zu diesen Wegen Immobilien? Können Sie Ihr Immobilienportfolio erläutern?
Schulze: Das Immobilienportfolio besteht aus Spezialfonds und Publikumsfonds für institutionelle Anleger mit einer regionalen Allokation in Europa und einer Beimischung in Skandinavien. Die Core- und Core-Plus-Strategien sind hinsichtlich der Nutzungsarten diversifiziert. In unserer aktuellen strategischen Asset-Allokation für Immobilien haben wir eine Zielrendite von 4,5 Prozent definiert. Das ist zurzeit allerdings nur in Teilen darstellbar.
Herrn Anders, in Ihren Spezialfonds haben Sie eine Immobilienquote von zehn Prozent. Was für Renditen liegen bei Ihnen im Ring?
Anders: Wir sind zur Hälfte über institutionelle Fonds in europäische Büroimmobilien investiert. Die Ausschüttungsrendite liegt bei etwa 3,5 Prozent. Im letzten Jahr blieb die Performance allerdings dahinter zurück. Wir sind auch in deutschen Einzelhandel investiert. Dort haben wir eine Performance zwischen vier und fünf Prozent, der laufende Ertrag liegt unverändert bei vier Prozent.
portfolio institutionell, Ausgabe 11/2013
Autoren: Tobias Bürger In Verbindung stehende Artikel:

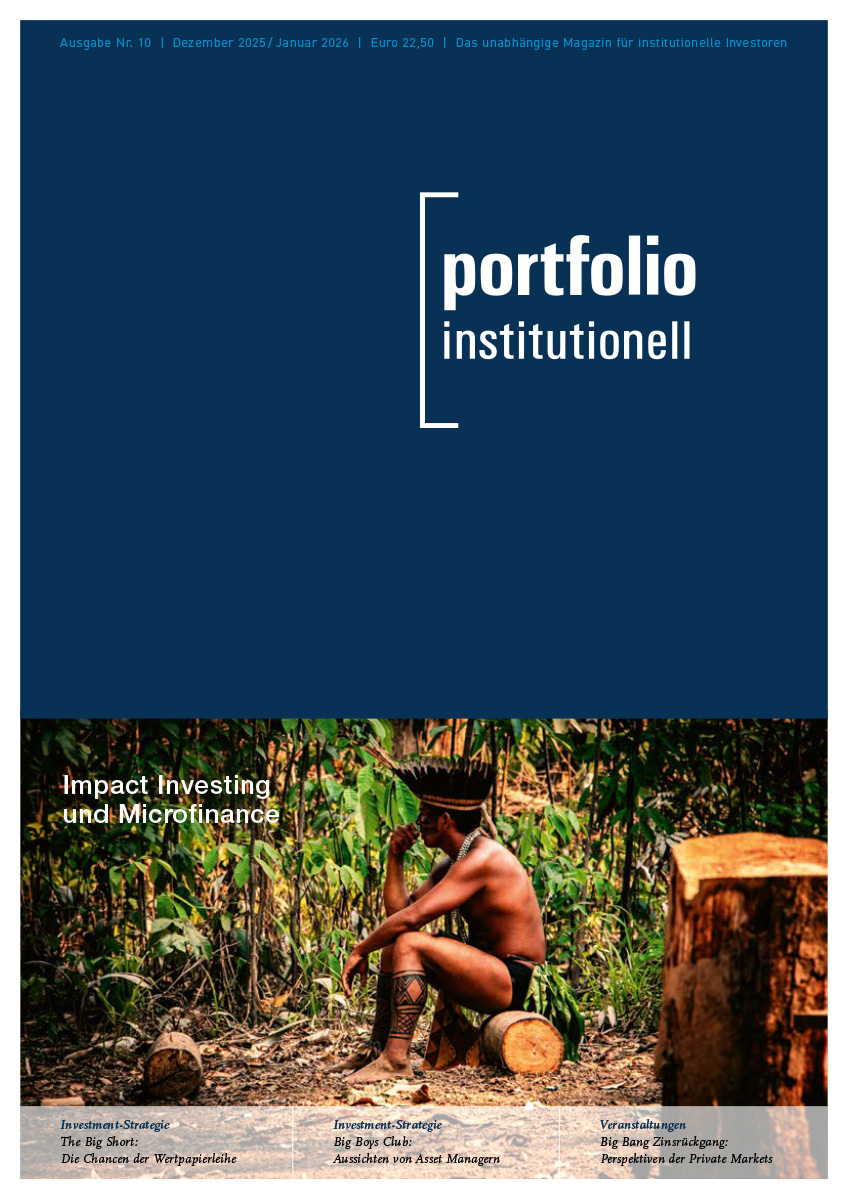
Schreiben Sie einen Kommentar