Mit starken Nerven und Risikofreude durchs Zinstal
Das Vermögen der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ist zum Großteil in Aktien, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur investiert. Von Rentenlastigkeit keine Spur. Einem Zinsanstieg sieht Holger Benke, Geschäftsführer der Stiftung, trotzdem mit Weh entgegen, wie Sie im Interview nachlesen können.
Ende März werden Sie die Hertie-Stiftung verlassen. Was hat Sie dazu bewogen? Wird es Änderungen in der Geschäftsführung geben?
Die Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Geschäftsführung werden neu sortiert. Wir wollen eine sehr klare Trennung zwischen den Geschäftsführern, die für die Projektarbeit zuständig sind, und denen, die administrative Aufgaben erfüllen, wie Asset Management, Rechnungswesen, Controlling, Personal und IT. In diesem Zusammenhang haben wir gemeinsam entschieden, dass ich etwas eher ausscheide als ursprünglich geplant. In zweieinhalb Jahren hätte ich die Stiftung altersbedingt verlassen.
Vielen Ihrer Stiftungskollegen macht das Niedrigzinsumfeld zu schaffen. Sie haben zunehmend Probleme, den realen Substanzerhalt zu schaffen und ihre Stiftungszwecke zu erfüllen. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Die vergangenen beiden Jahre zusammen betrachtet, waren die besten in der Geschichte der Stiftung. 2012 kamen wir auf eine Performance von 12,1 Prozent. Und auch 2013 sind wir mit 7,85 Prozent gut dabei. Wir sind sehr frühzeitig ins Risiko gegangen und haben hohe Aktienquoten gefahren. Ende letzten Jahres waren wir bei etwa 36 Prozent. Wenn andere Stiftungen das nicht gemacht haben, haben sie natürlich Ertragsprobleme im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Wir nicht.
Viele Stiftungen können kein höheres Risiko eingehen, weil die Gremien nicht mitspielen. Ihre Gremien scheinen recht offen zu sein?
Ja. In vielen anderen Stiftungen setzen sich die Vorstände meist aus Personen zusammen, die von der Geldausgabeseite kommen. Bei uns ist der Vorstand schwerpunktmäßig mit Bankern und Kaufleuten besetzt. Das ist in der Regel ein Vorteil. In der Regel sage ich, weil solche Gremien natürlich auch sehr anspruchsvoll sind und eigene Ideen und Vorstellungen haben. Darauf muss man sich als verantwortlicher Manager einstellen.
Wann haben Sie dieses hohe Aktien-Exposure aufgebaut?
Wir hatten schon immer eine relativ hohe Aktienquote. In unseren Anlageregeln steht, dass die Aktienquote mindestens 20 Prozent und maximal 40 Prozent betragen soll. Wir würden also nie auf die Idee kommen, die Quote auf zehn Prozent zu reduzieren, wobei nicht die Aktie als solche das Thema ist, sondern die Sachwertanlage. Der größte Teil unseres Vermögens soll in Sachwerte investiert sein, also Aktien, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.
Steckt dahinter Inflationsschutz?
So ist es. Wenn man sich die Stiftungen anschaut, die Jahrhunderte überlebt haben, sieht man, dass sie immer einen hohen Immobilienanteil hatten. Sie haben Kriege, die große Inflation in den 20er Jahren und Ähnliches überlebt. Ein hoher Sachwerteanteil war also immer gut.
An den Aktienmärkten gab es in den vergangenen Jahren viele Hochs und Tiefs. Wie verkraften Sie das?
Aktien erfordern starke Nerven, das ist klar. Es kommt also darauf an, dass die Gremien das seelisch aushalten. Das ist bei uns glücklicherweise der Fall. Wir halten die Risiken aus. Wir haben auch das Jahr 2008 überstanden, als die Performance des Gesamtvermögens bei 9,1 Prozent im Minus lag.
Hatte das Auswirkungen auf Ihre Projekte?
Wir sind in der glücklichen Lage, auch im Projektportfolio gut diversifiziert zu sein. Wir finanzieren nicht nur ein Projekt, sondern etliche in verschiedenen Bereichen, die wir von der Größenordnung her von Jahr zu Jahr variieren können. Wir können zudem in guten Jahren Projektrücklagen bilden, die dann in schlechten Jahren aufgelöst werden.
Haben Sie Sorge, dass die Aktienmärkte bald wieder abwärtsgehen?
Ja, das habe ich schon. Ich kenne die Argumente der Haussiers, laut denen die Aktien eigentlich nur steigen können. Die wichtigsten Argumente sind die Liquiditätsschwemme und die Niedrigzinspolitik. Trotzdem haben wir inzwischen bei vielen Indizes solche Höhen erreicht, dass schon kleinste Anlässe ausreichen können, um das System zum Kippen zu bringen. Das haben wir in der Vergangenheit bereits erlebt. Manchmal sind es Anlässe, die es an sich nicht wert wären, darauf zu reagieren. Aber die Anleger werden schnell nervös. Viele sitzen auf hohen Gewinnen, die sie mitnehmen wollen. Dann kommt der Schneeballeffekt zustande, der den Markt um 15, 20 oder mehr Prozent nach unten reißt. Die Märkte verlaufen in Trends. Leider weiß man erst hinterher, dass es ein Trend war. Wenn es gelingt, auf diesem Trend zur Hälfte oder zu zwei Dritteln mitzuschwimmen, ist das wunderbar. Dann kann man im Grunde vom durchschnittlichen Anleger nie mehr überholt werden. Diese zwei Drittel haben wir auf jeden Fall mitgenommen.
Was findet sich in Ihrem Aktienportfolio?
Wir haben 29 Prozent Europa und sieben Prozent Emerging Markets und Rest der Welt. Innerhalb Europas sind neun Prozent in Small und Mid Caps investiert. Das ist ein Marktsegment, das sich in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich entwickelt hat. Die übrigen europäischen Aktien liegen zum Großteil in Dividendenstrategien. Das hat sich in der Regel bewährt.
Sind die Dividenden der Grund, dass Sie sich für diese Titel entschieden haben?
Im Stiftungsbereich wird gern argumentiert, dass Stiftungen laufende Erträge brauchen. Das ist ein schönes Argument, wir denken jedoch in Performance. Ob der Ertrag aus laufenden Dividenden oder Kursgewinnen besteht, ist uns im Grunde egal. Die Dividendenstrategie, wobei mir der Begriff „Strategie“ schwer über die Lippen geht, weil es an sich eine Primitivstrategie ist, ist nichts Besonderes. Sie hat einfach funktioniert. Zudem kann man das relativ einfach umsetzen, so dass wir keine externen Asset Manager brauchen.
Und im Small- und Mid-Cap-Bereich?
Das lassen wir extern managen. Dafür haben wir ein aktives Mandat mit relativ hohem Volumen vergeben, das seit vielen Jahren gut funktioniert. Die Vergleichsindizes, die diese Märkte abbilden, wurden tatsächlich überwiegend geschlagen. Daneben gibt es ein kleineres Mandat, das noch in der Erprobungsphase steht.
Also glauben Sie an aktives Management?
Vorsicht! Das würde ich so nicht sagen. Eigentlich bin ich gegenüber aktivem Management immer sehr skeptisch gewesen. Stellen Sie sich die Masse der Anleger vor, die alle schlauer und besser sein wollen als der Durchschnitt. Das kann nicht funktionieren. Wenn der Index den durchschnittlichen Anleger abbildet und einige besser als andere sind, müssen logischerweise andere schlechter sein. In Anbetracht dessen sind wir bei einer Fifty-Fifty-Betrachtung. Hinzukommt, dass aktives Management viel Geld kostet. Man hat schnell ein oder zwei Prozent Kosten, die der aktive Manager erst reinholen muss. Die Hürde für aktive Manager, dauerhaft besser zu sein, ist also relativ hoch. Es gibt ein paar Manager, die es über längere Zeit geschafft haben, aber die Masse schneidet schlechter ab als derjenige, der einfach nur den Index kauft.
Wir haben einen Teil passiv, aber nicht überwiegend. Bei unserer Dividendenstrategie kann man darüber streiten, ob sie eine aktive oder passive Strategie ist. Auch dafür gibt es Indizes, die man nachbilden kann, im Grunde ist sie jedoch eine aktive Strategie.
Versuchen Sie, über Manager zu streuen?
Wir haben nicht viele Manager. Wie gesagt, die Dividendenstrategie managen wir selbst, und das ist ein großer Teil des Aktienportfolios. Unsere Small- und Mid-Cap-Mandate sind fremdgemanagt. Außerdem haben wir im Infrastruktur- und Immobilienbereich einige Investments, die aktienbasiert sind und fremdgemanagt werden. Somit haben wir eine gewisse Streuung. Wir haben aber keine gleichartigen Mandate auf etliche Manager verteilt. Small und Mid Caps werden von zwei Managern betreut, aber nicht von acht verschiedenen.
Wo ordnen Sie Immobilien- und Infrastrukturaktien ein? Im Aktienbereich?
Wir haben das geteilt. Die Immobilienaktien sind zu 50 Prozent der Immobilienquote zugeordnet, der Rest den Aktien. Die Frage nach der Höhe der Aktienquote ist deshalb recht schwer zu beantworten. Denn was ist die Aktienquote? Bei uns gehören auch Immobilien- und Infrastrukturaktien dazu. Darüber hinaus investieren wir in Zertifikate, die optionale Bestandteile in sich tragen. Soll ich diese Investments den Aktien zuordnen, obwohl das Risiko durch die optionalen Auffangnetze eigentlich geringer ist? Es ist schwierig, solche Fragen, die oft auch aus Gremien kommen, sauber zu beantworten. Bei Zertifikaten haben wir uns entschieden, sie voll der Aktienquote zuzurechnen, um das höchstmögliche Risiko zu zeigen. In Wahrheit haben Zertifikate ein geringeres Risiko.
Sind risikoreduzierende Strategien, wie Low Volatility, für Sie ein Thema?
Ich würde das nicht völlig ausschließen, allerdings haben Stiftungen das nicht nötig, weil sie einen ewigen Anlagehorizont haben. Zwar müssen wir jedes Jahr einen Jahresabschluss aufstellen. Aber im Grunde ist das ein künstlicher Termin. Der Anlagehorizont der Stiftung ist ewig. Die Volatilität braucht uns nicht zu stören. Wenn wir von der Aktie als Anlageinstrument überzeugt sind – und das sind wir –, müssen wir die Volatilität einfach hinnehmen. Entscheidend ist, ob die Gremien das seelisch aushalten. Um besser zu schlafen, könnte man seine Aktien ständig absichern. Dadurch schneidet man sich aber dauerhaft ein bisschen von der Performance ab.
Sie sichern also nicht ab?
Wir haben in der Vergangenheit zeitweise Teile des Aktienportfolios abgesichert, und ich will es für die Zukunft nicht völlig ausschließen. Im Wesentlichen bleiben wir aber langfristig im Risiko.
Sie haben sechs Prozent Private Equity. Andere Stiftungen lassen lieber die Finger davon wegen der mangelnden Implementierbarkeit in Spezialfonds und steuerlichen Infizierung.
Es wäre schön, wenn man Private Equity in Spezialfonds implementieren könnte, das geht aber nicht. Wir haben es auch nicht versucht, sondern nach und nach 20 Fonds in den Direktbestand gekauft. Im Grunde haben wir uns einen eigenen kleinen Dachfonds mit verschiedenen Vehikeln geschaffen. Venture Capital ist allerdings nicht dabei, es sind gereiftere Investments. Ein paar dieser Fonds sind gewerblich geprägt, was aber nicht schlimm ist. Die Furcht, dass das gesamte Portfolio infiziert wird, braucht man nicht zu haben. Bei diesen Fonds müssen wir eine steuerliche Ergebnisrechnung machen. Das ist lästig, aber machbar.
Sind Sie also zufrieden mit der Entscheidung, in Private Equity investiert zu haben?
Wir sind damit sehr zufrieden. Wir haben ein gut gestreutes Portfolio mit verschiedenen Fondstypen. Die Performance-Zahlen waren in den vergangenen beiden Jahren einen Tick besser als die Gesamt-Performance der Stiftung. Private Equity hat also geholfen, das Gesamtergebnis zu heben. Ein Faktor ist, dass die Bewertung von Private Equity nicht so volatil ist wie die von Aktien, wobei man sich hier ein Stück weit selbst etwas vormacht. Denn wenn der Aktienmarkt einbricht, bricht der Wert der Unternehmen im Private-Equity-Fonds ebenfalls ein. Man sieht es nur nicht, weil sie nicht an der Börse gelistet sind.
Stichwort „Gebühren“: Wie sehen Sie die Fee-Strukturen bei Private Equity? Zu teuer?
Die Gebühren sind teilweise recht sportlich. Ärgerlich sind vor allem die Gebühren, die sich auf zugesagte, aber noch nicht abgerufene Kapitalbeträge beziehen.
Lässt sich über die Gebühren verhandeln?
Wir sehen keine großen Chancen zur Verhandlung. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn zum Beispiel ein Fonds über fünf Milliarden Dollar aufgelegt wird und wir fünf Millionen zeichnen, können wir froh sein, überhaupt dabei zu sein. Wir können nicht anfangen, über Gebühren zu verhandeln. Das müssen die Größeren tun. Wir müssen es nehmen, wie es ist.
Was halten Sie von Performance Fees in anderen Asset-Klassen, wie Aktien?
Es kommt auf das Produkt an. Bei indexbasierten Produkten brauche ich keine Performance-abhängige Fee. Bei den Fonds, die wir aktiv managen lassen, haben wir eine Kombination. Wir haben eine fixe Management Fee und eine erfolgsabhängige Komponente. Bei einer stark erfolgsabhängigen Vergütung kommt es vor allem darauf an, die Risiken zu limitieren, damit der Manager nicht extrem hoch ins Risiko geht, um seine Fee zu pushen.
Wie ist es bei Immobilien? Hier gibt es vermehrt Diskussionen über Performance Fees.
Darüber brauchen wir nicht nachzudenken, weil wir unsere Immobilien im Eigenbestand halten. Wir haben lediglich zwei Fondsanteile, die aber nur geringe Anteile des Vermögens ausmachen.
Haben Sie nur in Deutschland Immobilien?
Bei nur Deutschland hatte ich jahrelang ein schlechtes Gefühl, weil wir hier im Grunde gegen die Portfoliotheorie verstoßen. Wir haben nicht nach Europa oder Amerika diversifiziert. Inzwischen bin ich froh darüber. Denn wenn wir diversifiziert hätten, wären wir 2008/2009 in Paris, New York und London massiv eingebrochen. Das sind wir in Deutschland nicht.
Wohnen stand zuletzt bei vielen Investoren ganz oben auf der Agenda. Auch bei Ihnen?
Nein. Wohnen ist ein streng regulierter Markt, in den der Staat zum Schutz der Mieter eingegriffen hat. Ich kann verstehen, dass der Staat das Bedürfnis verspürt, diesen Markt zu regulieren. Das Problem ist nur, wenn man als Anleger in Wohnungen investiert, muss man mit diesen Regulierungen leben.
Da Sie direkt in Immobilien investieren, wäre Wohnen sicher auch zu viel Aufwand?
Wir haben einen Immobilienmanager und einen Leiter Vermögensmanagement, der in allen Bereichen mitarbeitet – mehr nicht. Unsere gewerblichen Objekte werden extern von einem Manager betreut, was die Kleinarbeit angeht, und wir steuern das von der Stiftung aus. Wenn wir noch einen diversifizierten Wohnungsbestand dazulegen würden, wäre das relativ aufwendig. Wir müssten in Fondslösungen gehen. Bei Wohnungen waren die Renditen aber schon immer niedriger als im Gewerbebereich, so dass es von der Rendite her, wenn man die Management Fee für einen Fonds abzieht, schwierig wird. Deswegen sind wir nie in Wohnen gegangen. Rückblickend, wenn man den Preisanstieg betrachtet, den wir erlebt haben, wäre es gut gewesen, wenn wir investiert hätten. Aber der Hätte-Fonds ist ja immer der erfolgreichste.
Wie ist es mit Infrastruktur?
Hier haben wir ebenfalls investiert. Allerdings gibt es nicht viel. Es wird unheimlich viel darüber geredet, aber wenn man genau hinschaut, gibt es nur wenig vernünftige Angebote. Außerdem muss ein entsprechendes Produkt einfach verpackt sein, im Idealfall in einem Fonds oder einer Aktiengesellschaft, deren Aktien man kauft. Genau das haben wir in einem Fall gemacht. Die Aktie ist börsennotiert, so dass wir ähnlich wie bei Immobilien eine Mischung aus Infrastruktur- und Aktienrisiko haben. Darüber hinaus haben wir Infrastruktur in einer Fondslösung, allerdings nur in kleinen Portionen. Wir gehen nicht in Solar- oder Windanlagen, weil wir keine Produkte wollen, die nur aufgrund staatlicher Förderung rentabel sind und eine juristisch eigens dafür kreierte Verpackung haben. Hier ist der Prüfungsaufwand immens. Die Vertragsdokumentation kann durchaus 300 Seiten dick sein und ist häufig im besten juristischen Englisch verfasst. Man müsste das Vertragswerk an ein Anwaltsbüro geben, das darauf spezialisiert ist. Das kostet Zeit und Geld, und das wollen wir uns nicht antun. Bei standardisierten Produkten mit bewährten Verpackungen haben wir diese Risiken in der Regel nicht.
Sind Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung ein Thema für Sie?
Das haben wir ein Mal gemacht – mit ein bisschen Bauchschmerzen – und wir werden es wohl auch nicht wiedertun. Hier gilt das gleiche Argument. Wenn Sie einen Bauträger quasi mit Mezzanine-Kapital finanzieren, damit er in eineinhalb Jahren ein Hotel hochziehen kann, ist das eine sehr spezielle Finanzierungsform. Dafür braucht es entsprechendes Know-how, da sollte man nicht blauäugig hineingehen. Was passiert beispielsweise, wenn der Bauträger in Konkurs geht? Gehört uns dann eine halbfertige Bauruine? Wir sind nicht die Spezialkreditabteilung einer Bank.
Wie stehen Sie zu Mission Investing? Laut dem Bundesverband Deutscher Stiftungen lässt sich dadurch die Wirkung der Kapitalanlage um 300 Prozent hebeln.
Wir haben in unseren Anlagerichtlinien einen Satz, der lautet sinngemäß: Vermögensanlage und Zweckerfüllung sind strikt voneinander zu trennen. Das heißt, die Vermögensanlage soll nicht instrumentalisiert werden, um ideelle Ziele zu verfolgen. Dahinter stecken einfache Überlegungen. Zum Ersten sind Interessenkonflikte zu nennen. Ich veranschauliche das an einem Beispiel. Nehmen wir an, eine Stiftung fördert die Wissenschaft und investiert in ein Gebäude, das hinterher an Institutionen vermietet wird, die auf der Förderliste stehen. Ich garantiere Ihnen, es wird nur wenige Monate dauern, bis die erste Institution an die Stiftung herantritt und sagt: In diesem Jahr ist unser Budget sehr eng, so dass wir Schwierigkeiten haben, die Miete zu zahlen. Da Ihr uns sowieso fördert, könntet Ihr uns doch auch die Miete reduzieren. Dann stellt sich die Frage: Soll ich dieses Investment aus dem Asset Management heraus betreuen? In dem Fall versuche ich, die bestmögliche Rendite herauszuholen. Oder sehe ich es als Förderprojekt? In diesem Fall ist es keine rentable Vermögensanlage mehr, und mir gehen die Steuerungskriterien verloren.
Zweitens ist es schwer, überhaupt Investmentmöglichkeiten zu finden, die mit der Mission im Einklang stehen. Unser Förderprogramm ist sehr vielfältig. Wir haben verschiedene Bildungsprogramme, wenden uns an Menschen mit Migrationshintergrund, unterstützen die Hirnforschung und Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In diesen Bereichen etwas zu finden, das als Investment Sinn macht und trotzdem die Mission erfüllt, ist eine schöne theoretische Vorstellung, aber nicht leicht umzusetzen. Schließlich habe ich noch ein drittes Problem. Häufig werden damit neue Ziele definiert, die nicht in der Satzung stehen. Umweltschutz und ethische Vertretbarkeit sind Ziele, die wir alle gut und richtig finden. Aber wenn in der Satzung der Stiftung darüber nichts steht und der Stifter diese Ziele nicht vor Augen hatte, frage ich mich, ob ein Stiftungsvorstand das Recht hat, die Ziele einfach neu zu definieren und das Vermögensmanagement darauf auszurichten. Das ist quasi die Einführung neuer Stiftungsziele durch die Hintertür.
Ihre Rentenquote haben Sie sukzessive abgebaut. Bundesanleihen haben Sie gar nicht mehr. Was findet sich im Rentenportfolio?
Wir haben 28 Prozent Renten, davon ist etwa die Hälfte international in Corporate Bonds investiert. Die Duration ist eher kurz bis mittel. Darüber hinaus haben wir Pfandbriefe, Anleihen von Spezialkreditinstituten und Nachranganleihen, davon allerdings nicht viele. Außerdem sind wir in Emerging Market Bonds investiert.
In den Emerging Markets sind Sie 2012 eingestiegen. Das war nicht der beste Zeitpunkt.
Ja, wir sind ein bisschen zu spät eingestiegen, aber nicht mit einem dramatisch hohen Anteil. Es ist ein gemischtes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Wir haben zwei Fonds, von denen der eine nur in Lokalwährung investiert und der andere zum Teil Währungen hedgt. Ich finde lokale Währungen spannend, weil man nicht das große Dollar-Risiko hat. Oft sind diese Länder auch stabiler und solventer als die großen Staaten. Die Währung habe ich gern genommen – als Diversifikator.
Wie sieht es grundsätzlich mit der Währungsabsicherung aus?
Wir haben das Währungsrisiko nie separat abgesichert, sondern als Chance gesehen. Ich habe vor ein paar Jahren Modellrechnungen zu verschieden strukturierten Portefeuilles mit einem Mix aus Währungen gemacht und die realen Währungsentwicklungen dagegen laufen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass nie alle Währungen fallen, sondern immer gegenläufige Entwicklungen vorhanden sind. Wenn man ein bunt gemischtes Portfolio hat, spielt das Währungsrisiko also fast keine Rolle. Währungsrisiken gleichen sich sehr gut aus. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist: Wenn ich zum Beispiel Coca-Cola-Aktien kaufe, ist das vordergründig ein Dollar-Risiko. In Wahrheit ist Coca Cola rund um den Erdball diversifiziert. Sie haben Renminbi, Kanadische Dollar, Euro und Rubel. Das heißt: Wenn ich meine Coca-Cola-Aktien in Dollar absichere, habe ich noch andere Währungen, die sich womöglich in der Kursentwicklung der Aktie und der Dividende niederschlagen. Dann habe ich völlig falsch abgesichert. Deswegen sehe ich in einem Currency Overlay, für das wir auch noch Geld zu bezahlen haben, keinen großen Sinn.
Achten Sie darauf, von einem Unternehmen nicht den Bond und die Aktie zu halten, um kein Klumpenrisiko zu haben?
Richtig. Wir haben ein hausinternes Reporting. Wir legen unserem Anlageausschuss, der fünfmal im Jahr tagt, Risikosimulationen bezogen auf alle Asset-Klassen vor. Wir berichten auch sehr detailliert über Corporate Bonds. Dem Anlageausschuss werden Listen vorgelegt, in denen er die einzelnen Emittenten sehen kann. Gerade nach den letzten Krisen, als plötzlich einzelne Namen über Nacht angezählt wurden, sind wir dazu übergegangen, diese Risiken sehr eng zu überwachen.
Sie managen Ihre Corporate Bonds selbst?
Das machen wir selbst. Wir gehen aber nicht in Hochrisikoanleihen, sondern bewegen uns im mittleren Risikobereich, von dem wir meinen, dass das Risiko vertretbar ist, um es selbst zu managen. Wir kaufen also nicht nur die ganz sicheren Papiere, aber auch keine Junk Bonds.
Bei Corporate Bonds sind die Renditen inzwischen sehr eingelaufen.
Das war eine Performance-Quelle für uns. Die 12,1 Prozent im Jahr 2012 und die rund acht Prozent im vergangenen Jahr sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Spreads zusammengelaufen sind und zusätzliche Kursgewinne beschert haben.
Wir sind relativ früh eingestiegen. In den Jahren nach der Krise von 2008 hatten wir den Mut, Bestände aufzubauen.
Mit Ihrer niedrigen Rentenquote dürften Sie gut schlafen, falls die Zinsänderung kommt.
Wir haben bei unseren Renten eine Duration von etwas über drei. Das ist nicht viel. Da kann nicht wahnsinnig viel passieren. Aber wenn der Zinsanstieg käme, hätte das dramatische Auswirkungen auf die restlichen Märkte. Dann geht die Post ab, und zwar nach unten. Das hat auf Staaten dramatische Auswirkungen und wird den Immobilienmarkt in eine tiefe Krise stürzen. Denken Sie an die Investitionen, die mit Niedrigzinskrediten vorgenommen wurden. Wenn die zur Zinsanpassung anstehen und ein Kredit in der Zinsbelastung von drei auf beispielsweise 4,5 Prozent steigt, hört sich das nach wenig an, es sind aber 50 Prozent. Wenn ein deutlicher Zinsanstieg kommt, rutschen wir in eine tiefe Wirtschaftskrise. Davon bin ich überzeugt.
Also gehen Sie davon aus, dass es allein deswegen vorerst beim Niedrigzins bleiben wird?
Ja, es gibt offensichtlich einen Zwang, die Zinsen niedrig zu halten. Ob das allerdings auf Dauer geht, ist die Frage. Denn wir sehen die Fehlallokationen, die daraus entstehen. Was im Immobilienmarkt, insbesondere im Wohnungssektor abgeht, ist ganz klar eine Blase. Auch bei Gewerbeobjekten sehen wir das. Wir sind bei manchen Bürohäusern, bei denen wir mitgeboten haben, nicht zum Zug gekommen, weil andere Investoren bereit waren, zehn Prozent mehr zu zahlen als wir, was nicht mehr vernünftig war. Das ist uns in letzter Zeit des Öfteren passiert. Das heißt, auch am Büromarkt bildet sich eine Blase. Das ist eine Folge der Niedrigzinspolitik.
Was ist für Sie das größte Risiko? Inflation?
Die klassische Inflationslehre geht von der Geldmenge aus, die bei den Menschen ankommt. Bei der Geldmenge, über die wir im Moment reden, geht es um Bankenliquidität. Das ist ein ganz anderer Geldkreislauf. Deswegen funktioniert die Transmission der Geldmenge in die Realwirtschaft nicht direkt, sondern nur über die Zinsen. Solange das so bleibt, wird Inflation wahrscheinlich kein großes Thema sein. Und solange uns die Emerging Markets mit billigen Produkten versorgen, gibt es viel Preisdruck, so dass für ein richtiges globales Inflationsszenario die Voraussetzungen fehlen.
Das größte Risiko sehe ich in plötzlichen Ereignissen, wenn zum Beispiel Staaten unerwartet melden, dass sie ihren Haushalt nicht finanzieren können und ihre Zahlungsfähigkeit angezweifelt wird. Das Event-Risiko, das aus dem Komplex der Staatsverschuldung kommt, würde ich im Moment als größtes Risiko ansehen. Ansonsten gibt es Risiken, die nicht kalkulierbar sind, wie der Terroranschlag auf das World Trade Center.
Hat Sie Griechenland damals erwischt?
Die Hertie-Stiftung hatte 2,5 Millionen Euro in Griechenland investiert, das ist, gemessen am Vermögen, sehr wenig. Und auch die Krise der Asset Backed Securities, die aus den USA kam, hat uns nicht erwischt. Es gab zwei Gründe dafür, dass wir diese Papiere nicht hatten. Den einen habe ich Ihnen eben schon beschrieben: die umfangreichen Dokumentationen. Zum Zweiten haben wir uns immer gefragt, warum Banken, deren Geschäft es über Jahrhunderte war, Immobilienrisiken auf die eigenen Bücher zu nehmen, plötzlich anfangen, diese in Papiere zu verpacken und unters Volk zu streuen. Irgendetwas daran musste faul sein.
Inzwischen spricht man wieder häufiger über ABS. Wenn es vernünftig gemacht ist, ist das nicht verkehrt.
Das kann sein, aber es ist nicht unsere Welt. Wir haben eine kleine Truppe von guten Leuten, die sich in bestimmten Segmenten auskennen. Aber wir sind keine eierlegenden Wollmilchsäue, die alles können und auf jeden Zug aufspringen müssen.
portfolio institutionell, Ausgabe 2/2014
Autoren: Kerstin Bendix In Verbindung stehende Artikel:

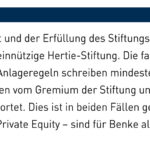

Schreiben Sie einen Kommentar