Zentralbanken mögen Aktien
Über die mit dem Verfehlen ihres Inflationsziels immer größer werdenden Frust-Shopping-Attacken der EZB auf den Anleihenmärkten ist so viel geschrieben wie gerätselt worden. Ungewissheit herrscht auch darüber, was die EZB wohl als nächstes kaufen könnte. Ein Blick in den Weltspiegel beflügelt die Fantasie.
Dass die Dividende der neue Zins sei, ist öfters zu lesen. So denken aber auch einige Zentralbanken, von denen man eigentlich annimmt, dass sie sich auf Staatsanleihen, Pfandbriefe und Gold konzentrieren. Ein Blick in den Geschäftsbericht der Schweizer Nationalbank (SNB) zeigt, dass in Zürich Aktien ein fester Bestandteil des Portfolios sind. Abgeleitet wird diese Allokation einmal davon, dass die helvetische Zentralbank einen wesentlichen Teil ihrer Währungsreserven in hochliquiden ausländischen Staatsanleihen anlegt, da die Sicherstellung des geld- und währungspolitischen Handlungsspielraums ein hohes Maß an Liquidität der Anlagen erfordert. Zum anderen besteht aber als eine Art Benchmark, dass nämlich die Rendite den langfristigen Aufwertungstrend des Frankens kompensieren muss, da alle Anlagen in Franken bewertet werden. Den Konflikt zwischen Liquiditäts- und Renditeziel versucht die SNB mit anderen Asset-Klassen zu lösen. „Mit ihrem Ansatz, einen Teil der Währungsreserven breit gestreut in Aktien und Unternehmensanleihen zu investieren, kann die Nationalbank den positiven Renditebeitrag dieser Anlageklassen nutzen. Gleichzeitig behält sie die Flexibilität, um ihre Geld- und Anlagepolitik an geänderte Bedürfnisse anzupassen“, teilt die SNB schriftlich mit. Im Jahr 2015 wurden auch darum zwei neue Anlageklassen eingeführt: Aktien aus Schwellenländern und in Renminbi denominierte chinesische Staatsanleihen. Laut der FAZ hielt die SNB Mitte 2016 Aktien im Wert von rund 120 Milliarden Franken. Das entsprach einem Fünftel der gesamten Devisenreserven. Nach den Angaben im Geschäftsbericht ist die Nationalbank breit diversifiziert an rund 6.700 Unternehmen beteiligt, von denen die meisten ihren Sitz in Industrieländern haben. Etwa 800 Beteiligungen hält sie in Schwellenländern.
Umgesetzt werden die Aktieninvestments, deren Quote seit 2010 von elf auf 18 Prozent stieg, über eine Kombination bestehender Marktindizes. So sollen politische Überlegungen außen vor bleiben und der Einfluss auf einzelne Märkte möglichst gering gehalten werden. Politische Erwägungen hat auch, dass man auf Investitionen in Aktien internationaler mittel- und großkapitalisierter Banken sowie bankähnlicher Institute verzichtet, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Zudem besetzt die Nationalbank das Thema Nachhaltigkeit mit Ausschlüssen von Aktien von Unternehmen, die international geächtete Waffen produzieren, grundlegende Menschenrechte massiv verletzen oder systematisch gravierende Umweltschäden verursachen. Zudem übte die Nationalbank, so berichtet die SNB über sich in der dritten Person, „über einen Stimmrechtsvertreter erstmals ihre mit den Aktienanlagen verbundenen Stimmrechte an Aktionärsversammlungen aus. Dabei beschränkte sie sich auf Aspekte der guten Unternehmensführung.“ Wie wichtig Governance-Aspekte sind, weiß die Schweizer Nationalbank aus ihrer eigenen Geschichte. Schließlich hat man mit Philipp Hildebrand einen SNB-Präsidenten verloren, da dessen damalige Gemahlin Kashya 504.000 US-Dollar über sein Konto gegen Schweizer Franken tauschte – verdächtigerweise im Vorfeld der Festlegung des damaligen Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken pro Euro.
Ganz überraschend ist die Aktienaffinität der Schweizer Zentralbank nicht, wenn man bedenkt, dass diese selbst, wie auch die belgische Nationalbank, an der Börse gelistet ist. Wer an der Anlagestrategie beispielsweise partizipiert, ist der Deutsche Professor Dr. Theo Siegert, ein ehemaliger Haniel-Manager, der mit einem Anteil von 6,6 Prozent nach dem Kanton Bern der zweitgrößte SNB-Aktionär ist.
The ETF-Whale
Auch bei der Bank of Japan erfreuen sich Aktien einer steigenden Beliebtheit. In Tokio werden die Anteilsscheine per ETF erworben. Laut Geschäftsbericht will man jährlich für etwa 26 Milliarden Euro shoppen. Dieses Ziel wurde laut der NZZ im Sommer verdoppelt. Vermutet wird, so die Schweizer Tageszeitung, dass die Bank of Japan bei ihren ETF-Käufen bevorzugt Fonds kauft, die sich am Nikkei-Index orientieren. Mit Blick auf die Renditen von japanischen Staatsanleihen, dem Kern der Asset-Allokation, machen Aktienkäufe aus Renditeüberlegungen viel Sinn. Allerdings droht bei diesen Volumina, dass die Zentralbank den Markt verzerrt. Ende 2016 dürfte die Zentralbank über ihre ETF-Käufe größter Anteilseigner in sechs Nikkei-225-Unternehmen sein, prognostiziert Bloomberg in einer Analyse. Und schon 2017 könnte die Notenbank bei etwa einem Viertel der 225 Unternehmen der größte Shareholder sein. Im Juni hielt die Bank of Japan 60 Prozent des japanischen ETF-Marktes, so dass Bloomberg die Notenbank als ETF-Whale titulierte. Analog könnte die EZB als Covered-Bonds-Wal bezeichnet werden.
Die im Nikkei 225 gelisteten Unternehmen dürfen sich einerseits über einen Großaktionär freuen, der weitere Stützungskäufe in Aussicht stellt und sich nicht einmischt. Ihr Export leidet aber darunter, dass heimische Aktienkäufe nicht zu einem fallenden Yen beitragen. Währungsaufwertungen zu vermeiden dürfte für die SNB auch ein Grund sein, ausländische Aktien zu kaufen. Einen ausgeprägten Home Bias beweist die Bank of Japan auch bei Immobilien. Hier stehen J-Reits in Höhe von umgerechnet etwa 800 Millionen Euro jährlich auf dem Einkaufszettel.
Zurück nach Europa. Neben der Schweizer Nationalbank investieren auch die Zentralbanken in Tschechien, Schweden und Dänemark in Aktien. In Prag sind die Asset Manager Blackrock und State Street Global Advisors für die Aktieninvestments mandatiert, die zehn Prozent der Reserven ausmachen. Als Benchmark vorgegeben sind der MSCI Euro, S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225, der kanadische S&P TSX und der australische S&P ASX 200. Aktieninvestments, so die Ceská Národní Banka, entsprechen den Prinzipien ihrer Reservenpolitik und werden abhängig von Opportunitäten getätigt. In Kopenhagen gibt man sich anspruchsvoll: „Zusätzlich zur Anforderung, über ausreichend liquide Devisenreserven zu verfügen, möchte die Nationalbank Dänemarks höchstmögliche Renditen erzielen, dabei jedoch ein konservatives Risikoniveau beibehalten. Darum ist ein Teil des Portfolios in Aktien investiert.“ Mit 16 Milliarden Kronen beziehungsweise 2,15 Milliarden Euro liegt der Wert der Aktien etwas über dem von Staatsanleihen ohne Top-Bonität (14 Milliarden Kronen), Gold (15 Milliarden Kronen) sowie deutlich über dem Wert von Unternehmensanleihen (fünf Milliarden Kronen).
Umgesetzt werden die Aktieninvestments über Aktien-Futures und ETF. Schwedens Riksbank beschäftigt sich in ihren Investmentaktivitäten auch mit Aktien, dominiert werden die Assets aber von Gold. Von dem Edelmetall hält die Bank 125,7 Tonnen, was Ende April 2016 einem Wert von knapp 47 Milliarden Euro entsprach. Seinen Ursprung hat das Asset, um den Wert der schwedischen Geldscheine und Münzen abzusichern. Heute hat das Edelmetall seine Existenzberechtigung vor allem darin, dass es einen Diversifikator zu den ausländischen Devisenreserven darstellt und als Notfallreserve für zum Beispiel Wechselkursinterventionen. Gebunkert wird der Goldschatz zur Hälfte bei der Bank of England und ansonsten bei der Zentralbank von Kanada, bei der Fed, der SNB und in eigenen Tresoren.
Letztes Beispiel: die Bank of Israel. Auch dieses Institut strebt höhere langfristige Renditen auf seine Reserven an und hat entsprechend seinen Risikograd erhöht. Dabei werden zwei Prinzipien beachtet: Die Reserven müssen ihre Kaufkraft erhalten und einen hohen Liquiditätsgrad aufweisen. In der Praxis führte dies dazu, dass die Bank of Israel ihre Aktienquote im vergangenen Jahr von 8,2 auf 9,2 Prozent erhöhte und dabei weitere Aktienmärkte berücksichtigte. Etwas antizyklisch wurden auch Unternehmensanleihen von 0,9 auf 4,6 Prozent erhöht.
Aktien spielen also auch für Zentralbanken eine bedeutende Rolle. Diversifikation, die Umsetzung von geldpolitischen Maßnahmen und natürlich Renditen sprechen für die Anteilsscheine. Zumindest noch ist auch die Liquidität ein Grund. „Das De-Leveraging der Banken reduziert die Sekundärmarktliquidität von Anleihen, Devisen und Rohstoffen sowie nach unseren Erkenntnissen zunehmend auch von Aktienmärkten“, so Dr. Frank Engels von Union Investment. Daneben spricht noch ein weiterer, nicht erwähnter Umstand pro Aktien: Basel III ist zwar ein Projekt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, also der Zentralbank der Zentralbanken. Für Zentralbanken selbst gilt Basel III aber nicht.
Von Patrick Eisele
portfolio institutionell, Ausgabe 11/2016
Autoren: Patrick Eisele In Verbindung stehende Artikel:
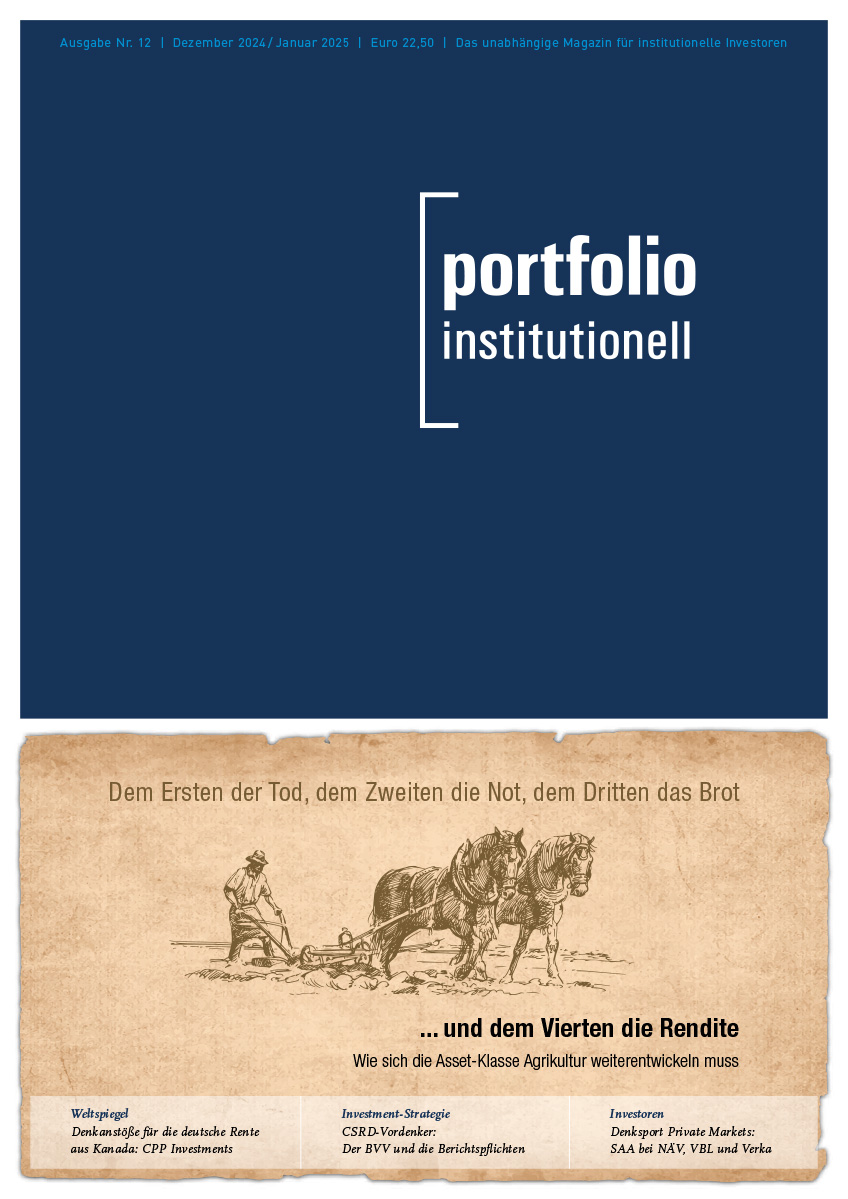
Schreiben Sie einen Kommentar